Wie funktioniert ein Exit?
Traditionelle Unternehmen werden gegründet, um langfristig von ihren Gründern geführt zu werden. In der Startup-Szene hat sich dagegen der Exit als Unternehmensziel etabliert. Das meint den Verkauf an ein anderes Unternehmen oder an einen Konzern. Die Gründer verkaufen ihre Anteile und steigen aus dem jungen Unternehmen aus. Einige Mitglieder des Gründerteam arbeiten auch noch einige Zeit im Unternehmen weiter, dass dann jedoch anderen gehört.
Millionenschwere Übernahmen von Startups durch Google, Facebook & Co sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Doch wie fließt das Geld bei einem Exit wirklich und was bleibt für die Gründer?
Startup-Gründer verfügen über Ideen mit Innovationspotenzial, doch ihnen fehlt es im Regelfall an Kapital. So kommen private Investoren, sogenannte Business Angels oder andere Venture Capital (VC)-Geber, ins Spiel. Die wissen aber, dass von elf Startups acht bis neun in den ersten Jahren scheitern. Umso bewusster investieren sie. Sie sind auf der Suche nach Geschäftsideen mit viel Potenzial und sichern sich durch entsprechende Verträge Chancen auf einen möglichst renditeträchtigen Exit.
Am Anfang steht die Unternehmensbewertung
Ehe eine Investition jedoch getätigt werden kann, muss zunächst der Wert des Startups bestimmt werden. Anhand dieser wird entschieden, wie viele Geschäftsanteile ein Investor zu welchem Preis erhält. Differenziert wird dabei zwischen einem „Post-Money“-Wert, bei dem das neue Kapital bereits eingepreist ist und dem Wert davor („Pre-Money“).
Da die gängigen Methoden zur Unternehmensbewertung hier jedoch nicht anwendbar sind, sind Startup-Bewertungen im Wesentlichen nur Prognosen. Zugrunde gelegt werden verschiedene Faktoren, wie die Attraktivität des Marktes, die Reputation der Gründer oder der Innovationsgrad der Produkte. Von der Einschätzung der Investoren und der guten Vorbereitung der Gründer hängt ab, auf welchen Wert man sich einigt. Der wird dann vertraglich festgehalten. Damit aber nicht genug…
Ein VC-Vertrag enthält komplexe Klauseln
Das ist beispielsweise von Mitveräußerungsrechten und –pflichten (Tag Along und Drag Along) die Rede, von Bezugsrechten und Verwässerungsschutzmaßnahmen (Anti Dilution), sowie von Liquidations- / Erlöspräferenzen (Liquidation Preferences).
Letztere sind besonders entscheidend. Sie greifen automatisch, sobald sich der Exit durch Verkauf von mehr als 50 Prozent der Unternehmensanteile realisiert. Sie kommen aber auch bei Liquidation eines gescheiterten Startups zum Tragen. Und sie entscheiden, welche Gesellschafter bevorzugt abgefunden werden und damit auch letzlich, wer wie viel am Exit verdient.
Aus Investorensicht sind Liquidationspräferenzen absolut notwendig; ohne sie kann ein Investor bei schlechten oder mäßigen Exit-Erlösen nur verlieren. Aber sie können auch dafür sorgen, dass Anschlussfinanzierungen schwierig werden. Oder dass Gründer beim Exit finanziell unverhältnismäßig benachteiligt werden.
Die Präferenzen können höchst unterschiedlich gestaltet sein. Geläufig ist: Last in, First out, das heißt die Investoren werden in der Reihenfolge ihres Einstiegs – die Letzten zuerst – abgefunden.
Als besonders fair gilt die einfache Präferenz mit Anrechnung (non-participating). Sie dient dem Schutz des Investors für den Fall, dass das Unternehmen unter dem Wert verkauft wird, der Bemessungsgrundlage für sein Investment war. Dieser Fall könnte z. B. durch eine Drag-Along-Verpflichtung eintreten. Dann müssen alle Anteile verkauft werden, sobald der Mehrheitsgesellschafter verkauft. Dank der Präferenz kann der Investor aber sein eingebrachtes Geld retten.
Bei einer nicht anrechenbaren (participating) Präferenz verdient der Investor zusätzlich am Erlös pro Anteil, ohne dass die Rückzahlung seiner Einlage angerechnet wird. Das ist vor allem bei hohen Exit-Erlösen interessant.
Möglich sind zudem Zinsvereinbarungen. Allerdings können die Investorenansprüche durch eine vertraglich festgelegte Obergrenze, den sogenannten „Cap“ gedeckelt werden.
Liquidationspräferenzen mit einem Faktor >1 waren zu Zeiten des New-Economy-Booms durchaus geläufig. Aktuell sind sie, zumindest in der deutschen Startup-Szene, aber eher selten. Sie können aber als Ausgleich zur Anwendung kommen, wenn der Gründer eine höhere Bewertung durchsetzt als der Investor für realistisch hält.

Augen auf beim Abschluss von VC Verträgen!
Wie sich eine nicht anrechenbare Präferenz mit Faktor 2 auswirkt, erläutert dieses Beispiel:
Ein Investor gibt vier Millionen Euro in ein Startup mit einer Post-Money-Bewertung von zehn Millionen Euro. Er erhält eine 2-fache nicht anrechenbare Liquidationspräferenz und 40 Prozent der Geschäftsanteile. Die vier Gründer ihrerseits halten weiterhin 60 Prozent – pro Kopf jeweils 15 Prozent. Auf dem Papier ist nach der Kapitalzufuhr nun jeder Gründer zweifacher Millionär.
Nach einem Jahr wird das Startup für zehn Millionen Euro verkauft. Jetzt erhält der Investor seine Einlage doppelt zurück: acht Millionen Euro. Da die Präferenz nicht angerechnet wird, stehen ihm von den verbleibenden zwei Millionen aufgrund seiner Geschäftsanteile weitere 800.000 Euro zu. Er hat also seinen Einsatz mehr als verdoppelt. Den vier Gründern bleiben 1,2 Millionen Euro – pro Kopf somit nur 300.000 Euro für ihre gute Geschäftsidee und hunderte Stunden harter Arbeit.
Vor Abschluss eines VC-Vertrages sollten unterschiedlichste Exit-Szenarien durchdacht und berechnet werden. Nur so lassen sich gute und faire Vereinbarungen zu finden. Denn, wer an einem Exit wie viel verdient, entscheiden letztllich die Verträge.


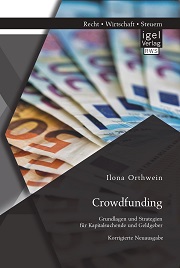
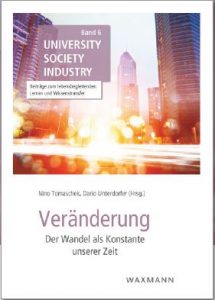
Über den Autor