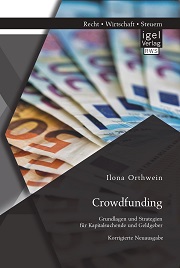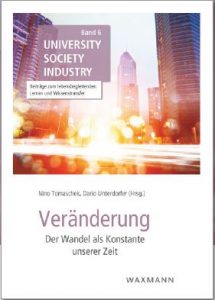Was Unternehmen zur e-Rechnung wissen müssen
Am 1. Januar 2025 wird die e-Rechnung (elektronische Rechnung) in Deutschland für Unternehmen zur Pflicht.
Diese bedeutende Änderung betrifft viele Bereiche des Geschäftsalltags und stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick, wer betroffen ist, welche Anforderungen bestehen, welche Formate und Übergangsregelungen es gibt.
Was bedeutet die Einführung der e-Rechnung?
Die e-Rechnung ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, sodass sie automatisiert verarbeitet werden kann. Im Gegensatz zu PDF- oder Papier-Rechnungen enthalten e-Rechnungen maschinenlesbare Daten (z. B. in XML-Formaten). Ziel der Umstellung ist die Effizienzsteigerung, eine Reduktion von Fehlern und die Förderung der Digitalisierung in Unternehmen und öffentlichen Institutionen.
Wer ist betroffen?
Die Einführung der e-Rechnung betrifft:
- Alle Unternehmen, die umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen. Sie sind verpflichtet, Rechnungen in elektronischer Form auszustellen, sofern der Leistungsempfänger ebenfalls ein Unternehmen ist (B2B-Bereich).
- Öffentliche Auftraggeber. Im Bereich B2G (Business-to-Government) gilt die Verpflichtung zur e-Rechnung bereits seit 2020, sie wird jedoch nun weiter ausgebaut.
- Freiberufler und Kleinunternehmer müssen ebenfalls e-Rechnungen ausstellen, wenn sie für Geschäftskunden oder öffentliche Institutionen arbeiten.
Ausnahmen: Rechnungen an Endverbraucher (B2C) und bestimmte Kleinstrechnungen (unter 250 Euro) können von der Regelung ausgenommen sein. Hierzu wird eine genaue Klärung der gesetzlichen Details erwartet.
Was müssen Unternehmen beachten?
- Rechnungsausstellung: Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Rechnungen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format übermittelt werden.
- Anpassung der IT-Systeme: Um e-Rechnungen zu erstellen, zu versenden und zu empfangen, müssen Unternehmen ihre IT-Infrastruktur überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Dies kann die Anschaffung oder Erweiterung von ERP-Systemen beinhalten, die den Umgang mit e-Rechnungsformaten ermöglichen. Alternativ gibt es auch spezialisierte Dienstleister oder Softwarelösungen, die sich einfach integrieren lassen.
- Auswahl des richtigen Formats: Unternehmen müssen klären, welches Format sie verwenden, je nach Kundenanforderung oder Branche.Die e-Rechnung kann in verschiedenen standardisierten Formaten übermittelt werden.
Die wichtigsten Formate in Deutschland sind:
ZUGFeRD (Version 2.2 oder höher): Unterstützt sowohl maschinenlesbare Daten (XML) als auch ein optionales PDF für die Ansicht. Und XRechnung, das ist ein XML-basiertes Format, das besonders für den öffentlichen Sektor (B2G) vorgeschrieben ist.
- Übermittlung und Plattformen: Neben der Erstellung der e-Rechnung müssen Unternehmen auch den Übermittlungsweg beachten. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- E-Mail mit e-Rechnungsanhang: Der strukturierte Datensatz wird per E-Mail verschickt.
- PEPPOL-Netzwerk: Eine sichere Infrastruktur, die speziell für den Austausch von e-Rechnungen entwickelt wurde.
- Rechnungsportale: Öffentliche Auftraggeber stellen oft eigene Plattformen bereit, auf denen Lieferanten ihre Rechnungen hochladen können.
- Archivierungspflichten: Auch e-Rechnungen unterliegen den gesetzlichen Anforderungen der GoBD (Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern). Unternehmen müssen sicherstellen, dass die Daten revisionssicher gespeichert werden. Das bedeutet, dass die Rechnungen für den gesamten Aufbewahrungszeitraum (10 Jahre) unveränderbar, nachvollziehbar zugänglich bleiben.
- Schulung der Mitarbeitenden: Die Einführung der e-Rechnung erfordert möglicherweise Schulungen für die zuständigen Mitarbeiter/innen, insbesondere in der Buchhaltung und im Rechnungswesen.
- Vertragsprüfung und Kommunikation: Unternehmen sollten bestehende Verträge mit Geschäftspartnern prüfen und gegebenenfalls anpassen. Es ist wichtig, Kunden und Lieferanten frühzeitig über die Umstellung auf e-Rechnungen zu informieren und die bevorzugten Formate und Übermittlungswege abzustimmen.
Übergangsregelungen: Was gilt bis zur endgültigen Pflicht?
Für die Einführung der e-Rechnung zum 1. Januar 2025 gibt es Übergangsregelungen, um Unternehmen die Umstellung zu erleichtern:
Testphase und Pilotprojekte: Einige Branchenverbände und Behörden haben Pilotprojekte gestartet, um Unternehmen bei der Umstellung zu unterstützen.
Übergangsfrist für Kleinunternehmen: Kleinere Unternehmen werden voraussichtlich etwas länger Zeit erhalten, um ihre Systeme anzupassen. Bis 2028 sollte die e-Rechnung allgemein Anwendung finden.
Hybridlösungen: Bis zur vollständigen Umstellung dürfen Unternehmen in einigen Fällen noch parallele Prozesse nutzen, etwa PDF-Rechnungen mit angehängten XML-Daten.
Erleichterungen für Kleinstbeträge: Für Rechnungen mit geringen Beträgen oder Rechnungen, die bar beglichen werden, könnten Vereinfachungen gelten.
Fazit: Vorbereitung ist entscheidend
Die Einführung der e-Rechnung bringt Herausforderungen, aber auch erhebliche Vorteile: geringere Fehlerquoten, schnellere Bearbeitung und eine verbesserte Nachverfolgbarkeit von Geschäftsvorfällen. Unternehmen sollten sich frühzeitig informieren und Maßnahmen ergreifen, um reibungslos auf die neuen Anforderungen vorbereitet zu sein. Eine gute Planung, die Anpassung von IT-Systemen und die Schulung der Mitarbeiter sind wesentliche Schritte, um den Übergang erfolgreich zu meistern.
Sind Sie bereit für die e-Rechnung? Der Countdown läuft!