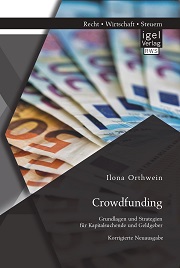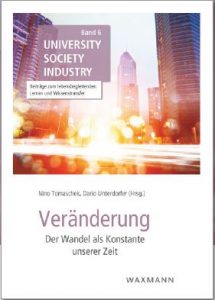Sprachschul-Gründer Yousef El-Dada und Asmaa Aldaher zeigen, was möglich ist
Das arabische Wort „Fekra“ bedeutet „Idee“. Eine gute Idee war es zweifellos, die der Architekt Yousef El-Dada und seine Partnerin, die angehenden Zahnärztin Asmaa Aldaher, hatten. Muttersprachlicher Arabisch-Unterricht, der ganz weltlich ist und sich von den Erkenntnissen moderner Pädagogik leiten lässt.

Yousef El-Dada und Asmaa Aldaher in der Sprachschule
Seit Anfang 2018 können Kinder ab Grundschulalter bei „Fekra“ in der Kleiststraße, nahe Wittenbergplatz Arabisch lernen. Die Räume der Schule sind groß, hell und freundlich, die Gruppen sind klein und die Lehrer sehr erfahren und das Lernen erfolgt spielerisch.
Das Credo der Gründer lautet: „Wir möchten die arabische Hochsprache in korrekter Form und losgelöst von religiösen und politischen Überzeugungen unterrichten, und zwar so, dass die Kinder viel Freude am Lernen haben.“
Das Konzept kommt bei Kindern und Eltern sehr gut an. Inzwischen arbeiten bei „Fekra“ fünf ausgesucht qualifizierte Lehrkräfte und mehr als 50 Kinder kommen regelmäßig zum Unterricht. Die Nachfrage ist außerdem so groß, dass man zum kommenden Jahr über einen weiteren Ausbau des Angebots nachdenkt. Im Gespräch sind Angebote für Kita-Kinder und für ältere Schulkinder, u. a. zum Umgang mit digitalen Medien bis hin zu Programmierkursen für Mädchen und Jungen.

Stolz präsentieren Kinder ihre selbstgebastelten arabischen Grüße zum Muttertag, Bildquelle ©Fekra
Was hat das Gründercoaching gebracht?
Yousef El-Dada: Ilona Orthwein arbeitet sehr lösungsorientiert, ist bei allen auftretenden Fragen immer für uns da. Sie hat viel Geduld und gibt sich wirklich sehr viel Mühe, auch schwierige Probleme zu lösen. Das ist keineswegs selbstverständlich. Sie hat uns außerdem in vielen praktischen Dingen Tipps gegeben, z. B. bei behördlichen Anmeldungen, bei der Ausgestaltung von Verträgen und im Bereich PR und Marketing. So konnten wir dank des Coachings rasch wachsen. Ökonomisch ist die Leitung der Sprachschule inzwischen ein wichtiges zweites Standbein für mich geworden.
Asmaa Aldaher: Ich kann das, was Yousef über Ilona Orthwein sagt, nur bestätigen. Außerdem möchte ich betonen, dass ich mich bei Ilona Orthwein immer als Klientin auf Augenhöhe empfand. Das ist leider nicht der Normalfall. Ich lebe seit langem in Deutschland, habe hier eine Berufsausbildung gemacht, gearbeitet und studiere inzwischen. Man kann sagen, ich bin gut integriert. Trotzdem werde ich als muslimische Frau und Migrantin von häufig schief angesehen und oben herab behandelt. Bei Ilona Orthwein dagegen ist das ganz anders. Hier fühlte ich mich von Anfang an ernst- und angenommen.
Die Meinung der Beraterin
Ilona Orthwein: Mich freut es sehr, welch großen Zuspruch das Angebot von „Fekra“ erhält. Jedes Mal, wenn ich zur Beratung in die Schule komme, treffe ich auf ausgesprochen fröhliche Kinder und zufriedene Eltern. Aber auch betriebswirtschaftlich geht das Konzept auf. Dabei wurde das Gründerpaar sogar für seine Idee anfänglich verlacht.
Solche Ablehnung hat mit Denkblockaden und unserem Denken in defizitären Kategorien zu tun. Wir haben es uns angewöhnt, unser Augenmerk auf das zu richten, was fehlt und übersehen dabei das, was da ist. Statt zu überlegen, wo Potenziale und Chancen sind, sehen wir vor allem die Mängel, die es zu beseitigen gilt. Gerade migrantische Gründer*innen leiden unter solch einem Ansatz.
Im Falle von „Fekra“ war das Potenzial eigentlich mit Händen zugreifen. Berlin hat eine riesige arabisch-deutsche Community. Weltlichen muttersprachlichen Arabisch-Unterricht gibt es dennoch kaum.
Warum muttersprachlicher Arabisch-Unterricht?
In Berlin leben über 130.000 Menschen mit arabischen Wurzeln. In ihren Familien wird, wenn überhaupt, Arabisch als die in der jeweiligen Heimatregion übliche Umgangssprache gesprochen. Diese regionalen Dialekte unterscheiden sich zum Teil erheblich voneinander. Noch mehr unterscheiden sie sich von der allgemeinen arabischen Hoch- bzw. Schriftsprache. Nur, wer die Hochsprache beherrscht, ist in der Lage, schriftlich zu kommunizieren, Zeitungen und Bücher zu lesen, Nachrichtensendungen zu verstehen etc. Fehlt diese sprachliche Bildung ist eine kulturelle Entfremdung die unweigerlich. Und eine Rückkehr und Re-Integration in die Herkunftsländer wird damit, insbesondere für die Kinder von Geflüchteten, erschwert.
An allgemeinbildenden Schulen wird mutterspachlicher Arabischunterricht dennoch bislang kaum angeboten. Moscheen, Moscheevereine oder religiöse islamische Zentren sind in diese Lücke gestoßen. Hier wird der Sprachunterricht an die Unterweisung in der islamischen Religion gekoppelt. Pädagogische Standards sind zudem oft fragwürdig. Auch ist die Lernatmossphäre in vielen dieser Einrichtungen alles andere als optimal. Überdies sind längst nicht alle Menschen mit arabischer Muttersprache Muslime. Gerade unter den arabischen Flüchtlingen, die um das Jahr 2015 zu uns gekommen sind, gibt es viele Christen, Yesiden und andere religiöse Minderheiten, sowie Religionslose. Auch gibt es viele arabisch-stämmige Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben. Teilweise in Mischehen. Sie sind gut integriert und möchten gerne ihren Kindern den Weg zur arabischen Kultur offen halten. Das geht vor allem über die Sprache und die vielfältige arabische Literatur. Diese hatte ihre ersten Blüten übrigens schon lange vor dem Islam in der alt-arabischen Poesie.